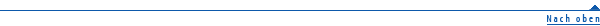Presse & Kommunikation
Nr. 39 Frühjahr 2004
Inhalt
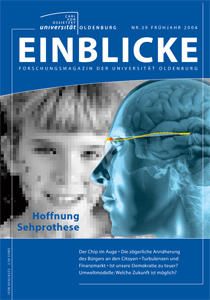 |
 die
Universität Oldenburg hat in den letzten Monaten zwei besonders herausragende
Erfolge verbuchen können: die Genehmigung des Sonderforschungsbereichs AVACS,
mit dessen Hilfe die Steuerungssysteme von Verkehrsmitteln erheblich sicherer
gemacht werden sollen, und die weitere Förderung der Forschergruppe BioGeoChemie
des Watts, die in den kommenden drei Jahren ihre wichtigen Untersuchungen in der
Nordsee fortsetzen kann. Beide Male ist die bedeutendste Forschungsförderungseinrichtung
in Deutschland, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der Finanzier. Insgesamt
zwölf Millionen € wendet sie für die beiden großen Projekte
auf.
die
Universität Oldenburg hat in den letzten Monaten zwei besonders herausragende
Erfolge verbuchen können: die Genehmigung des Sonderforschungsbereichs AVACS,
mit dessen Hilfe die Steuerungssysteme von Verkehrsmitteln erheblich sicherer
gemacht werden sollen, und die weitere Förderung der Forschergruppe BioGeoChemie
des Watts, die in den kommenden drei Jahren ihre wichtigen Untersuchungen in der
Nordsee fortsetzen kann. Beide Male ist die bedeutendste Forschungsförderungseinrichtung
in Deutschland, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), der Finanzier. Insgesamt
zwölf Millionen € wendet sie für die beiden großen Projekte
auf.
Die Beispiele zeigen, dass auch an einer mittelgroßen
jungen Universität Spitzenforschung etabliert werden kann. In Oldenburg gilt
das u. a. auch für die Gehirn-, die Akustik- und die Hörforschung. Zur
Spitzenforschung bedarf es allerdings nicht nur herausragender WissenschaftlerInnen,
sondern auch einer Hochschulpolitik, die die Stärken des eigenen Hauses gezielt
fördert - notfalls zu Lasten von Bereichen, deren Leistungen nur begrenzt
zu Buche schlagen. In Zeiten großer Mittelknappheit, deren Ende nicht abzusehen
ist, lassen sich nur auf diesem Weg Exzellenzen aufbauen, die langfristig das
Profil einer Universität prägen und sie zu einem gewichtigen Partner
in der Forschungslandschaft machen, aber auch zu einem attraktiven Ort für
Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen.
Die Bundesregierung
ignoriert diesen Tatbestand mit ihrem neuen Konzept zur Bildung von Eliteuniversitäten.
Sie möchte offensichtlich nach angelsächsischem Vorbild in Deutschland
Cambrigdes und Oxfords schaffen - Hochschulen, die sich in allen Lehr- und Forschungsbereichen
an der Spitze ihres Landes bewegen. Einmal davon abgesehen, dass die dafür
jährlich vorgesehenen 250 Millionen € nicht ausreichen werden, um ein
solches Ziel zu erreichen, macht es keinen Sinn, dass ein über Jahrhunderte
gewachsenes System einem anderen - ebenfalls mit einer langen Tradition - einfach
übergestülpt wird. Das Scheitern ist vorauszusehen. Auch die großen,
besonders renommierten Universitäten in Deutschland können nicht von
sich behaupten, sie hätte keine Schwächen oder könnten diese in
kurzer Zeit abbauen.
So sehen es auch die Wissenschaftsminister der
Länder, die sich in seltener Eintracht gegen das „Angebot“ der
Bundesregierung wehren. Sie wollen lieber allen Universitäten die Chance
geben, Spitzenleistungen hervorzubringen, und so den Wettbewerb weiter fördern.
Sie wissen nämlich, dass nicht selten die eher jungen, nicht verkrusteten
Universitäten offen für neue Wege sind - in Forschung und Lehre.
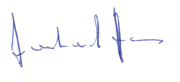
Gerhard Harms